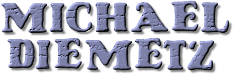◾ Erst einmal das Kapitelverzeichnis, um Euch neugierig zu machen. Text- Auszüge sind weiß markiert.
- Vorwort
- Wie kommt eigentlich ein Berliner zum Bergsteigen?
- Mein erster Klettertag ... überlebt!
- ... und der zweite – nie wieder!
- Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt
- 8.8.81, mein Schutzengel leistet Schwerstarbeit
- Treffen mit Tino und Olli
- „Die linke!”
- Der Club der Invaliden humpelt durchs Riesengebirge
- Von wackelnden Felsnadeln und abseilenden Höhlenspinnen
- Von Antigravitationsgürteln und Raketenstiefeln
- Camillo und die Amselseekante
- Waschbrett und Genießerspalte
- Splittergruppe Luginsland und Rettung eines Unbekannten
- Von Erstbegehungen und Freudentränen
- „Dor Dinou is nisch zähme”
- Ein Mastika...gucken Mädchen...zwei Mastika...guuut!
- Von röhrenden Hirschen und super Abkürzungen
- über die Herkunft des Wortes Donnerbalken
- Erster Sturz und ein Knoten, der sich von alleine löst
- Vexierturm total und Abflug an der Drohne
- Audienz beim Papst, Krönung Lugi IX.
- Zwei furchteinflößende Nachterlebnisse
- Gipfelstürmerweg und Wackerhangel
- „Sitz doch mal ordentlich!”
- Stierkampf-Training am Pfaffenstein
- Der Elefantenohr-Orgasmus
- Räuberhöhle und Bussardwand
- „Sie schickt der liebe Gott!”
- Von Schmelzkäseeis und Herzschrittmacher-Problemen
- Republikflucht und „Besuch” bei der Stasi
- Abschied von Olli
- Zwar kein Achttausender, aber dennoch in der Todeszone
- Blitzeinschlag im Bielatal
- Eingabe an den Staatsrat
- Vorkommnis an der Grenze und Wiedersehen mit Ewu
 9. Der Club der Invaliden humpelt durchs Riesengebirge (Auszug) 9. Der Club der Invaliden humpelt durchs Riesengebirge (Auszug) 
...Wir hatten die verrückte Idee, alle für uns machbaren Gipfel um die Basteibrücke herum zu besteigen. Da sind zwar immer sehr viele Leute, aber mitten in der
Woche wird sich das wohl in Grenzen halten. Dachten wir. Frühmorgens war das auch kein Problem. Doch schon bald konnten wir sehen, wie die Fähre 150 m unter uns
immer mehr Touristen über die Elbe schipperte. Sicher war auch bald der Parkplatz in entgegengesetzter Himmelsrichtung bis auf den letzten Platz gefüllt und
zusätzlich hat wohl ein Reisebus nach dem anderen ganze Massen von Urlaubern herangekarrt. Immer wieder schrie irgend ein Kind: "Mutti, kuck mal, Bergsteiger!"
Wir zählten mit: 16 mal! Und Mutti guckte dann auch, zumeist mit offenem Mund, während Vati emsig den Kameraverschluss klicken ließ. Irgendwie schien die berauschende
Aussicht gar nicht mehr so interessant zu sein. Als wir von unserem zweiten Gipfel an diesem Tag, der Steinschleuder, wieder auf die Basteibrücke heruntergeklettert waren,
fragte dann eine von den vielen Muttis, und das ist kein Scherz, ob sie uns einmal ANFASSEN dürfe. Sie durfte und war aus uns nicht ganz verständlichen Gründen danach total
verzückt. Und nachdem der Vati einen halben Film mit den Bildern von der Mutti zusammen mit ein paar Exemplaren der Gattung Mensch, Unterart: Ganz bestimmt völlig verrückter
und vielleicht auch etwas heroischer Kletterer, verschossen hatte, musste Mutti die Kamera übernehmen, um den Rest des Filmes von Vati Arm in Arm mit diesen exotischen und
höchst selten anzutreffenden Wesen noch schnell leer zu machen. Nicht zu vergessen, die lieben Kleinen. Und fünf Meter weiter standen die nächsten Muttis und Vatis oder
Omis und Opis. Wir brauchten eine halbe Stunde, um uns 20 m auf der Brücke weiter zu bewegen. Dort stiegen wir erst einmal über das Geländer, gingen auf einem breiten
Sandband bis zu einer Terrasse direkt oberhalb der Elbe, wo wir den Blicken und Objektiven der Paparazzis verborgen blieben und ruhten uns von unserem anstrengenden
Model-Dasein aus.

Die Basteibrücke. Neurathener Felsentor, Steinschleuder, Jahrhundertturm, Sieberturm (hinter Bäumen)
Nach erholsamer Pause beschlossen wir, erst einmal auf der Seite der Felsen zu klettern, die man von der Brücke aus nicht sehen konnte. Schubi schaute sich
einen der Wege dort an, sagte uns, dass der gut aussähe und er den machen wolle und fragte nach der Schwierigkeit. Der obligatorische Blick in den Kletterführer
verhieß nichts Gutes. Es war nämlich eine VIIb. "Elbweg" am "Neurathener Felsentor". Aber Schubi, der gerade mal einen Monat vorher seine erste VIIa
vorgestiegen war, ließ sich durch nichts abschrecken. Nur nicht wieder zurück zu den Menschenmassen. Keine Viertelstunde später grinste er uns vom Gipfel aus
an und teilte uns mit dem Prädikat "gängig" seine persönliche Einschätzung des Weges mit. Dabei vergaß er geflissentlich, dass sogar er sich mit seinen 1,92 m
ein paar mal ganz schön lang machen musste. Aber mit einem Seil von oben, das zudem noch von Schubis Riesenhänden gesichert wurde, konnte man alles probieren.
Olli und ich kamen dann auch irgendwann oben an, Martin war ein-fach noch nicht so weit und pendelte immer wieder aus der Wand. Also rauchte Schubi sein
Gipfelpfeifchen und machte, nachdem wir uns eingeschrieben hatten, die Abseile fertig, die bezeichnenderweise genau auf der Brücke endete. Als er das Seil in
lockeren Schlaufen aufgewickelt in einer Hand hielt, blickte er nach unten und rief "Seilwurf!" Aber das interessierte die "Touries" auf der Brücke nicht ein
bisschen. Manche blieben stehen und schauten nach oben, andere gingen einfach weiter. Nachdem er ihnen zum zweiten Mal das gleiche Kommando fast schon zugebrüllt
hatte und eine alte Frau mit hohem, dünnem Stimmchen geantwortet hatte: "Ja, machen Sie nur, junger Mann!", fiel ihm sicher auf, dass die da unten in Unkenntnis dieses
Begriffes ja gar nichts damit anfangen konnten. "Ich schmeiß hier gleich das Seil runter!", schrie Schubi jetzt. Als wenn man einen Stein ins Wasser geworfen hätte,
bewegte sich jetzt - mit Rufen, wie "Nein!" oder "Warten Sie!", wobei die piepsige Stimme der Omi fast die lauteste war - nach allen Richtungen eine kreisförmige Welle
aus Menschen von dem Punkt weg, der sich direkt unter Schubi befand und wo deshalb der Aufschlag des Seiles zu erwarten gewesen wäre. Jetzt konnten wir abseilen,
Olli ruhig und langsam, ich in kleinen Hüpfern und Schubi machte ein bisschen Show, indem er sich furchtbar schnell und in einem Zug fast bis kurz über die Brücke
fallen ließ, mit einem Ruck abbremste und stand. Erst ging ein Raunen durch die Menschenmasse und dann hörten wir, wie flüsternd, aber sicher mit großer Sachkenntnis,
unsere jeweilige Art, abzuseilen, bewertet wurde. "Ich fand den Großen besser." "Nee, beim Kleenen sah das lockerer aus." Auf jeden Fall gingen aber jetzt der Große
und der Kleine zusammen mit den beiden Mittleren ganz schnell um die nächste Ecke und suchten sich einen etwas abseits vom Weg liegenden Gipfel, an dem sie sich dann
auch ein paar Stunden aufhielten.
Zurück kamen wir erst wieder, als zu erwarten war, dass aufgrund der fortgeschrittenen Stunde die großen Touristenströme schon lange wieder unterwegs in Richtung
Dresden, Berlin oder Philadelphia waren. Philadelphia??? Ja, richtig gelesen: Philadelphia in Pennsylvania. Aber erst einmal stieg Schubi direkt von der fast leeren
Brücke aus eine Fünf auf den "Sieberturm" vor, bei dem man erst auf einen ganz schmalen Pfeiler klettern muss. Von dort gelangt man an die eigentliche Wand des Gipfels
mittels eines übertritts. Man lässt sich also nicht zuerst mit den Händen an die gegenüberliegende Wand fallen, sondern beginnt mit einem nicht minder schwierigen
Spreizschritt. Das schlimme war, dass man aus nur ein paar Metern Entfernung jede unserer Bewegungen "live" mitverfolgen konnte. Wieder sammelte sich eine Menschentraube,
wieder klickten die Fotoapparate. Als ich auf dem Pfeiler stand, flüsterte mir Schubi "Kamera" von oben zu. Ich blickte dezent nach unten und tatsächlich, wir wurden
gefilmt. Ich flüsterte zurück "Show?" und als Schubi nickte, bedeutete ich ihm mit meinen Händen, dass er mich schön straff sichern solle. Dann machte ich einen
Überfall, theatralisch in die Länge gezogen, indem ich mehrmals ansetzte und mich dann doch nicht "traute". Ein Übertritt wäre viel einfacher gewesen, sieht aber
nicht so spektakulär aus. Als ich die Füße rübernahm, tat ich so, als würden mir einer davon wegrutschen. Raunen. Drei Meter höher "rutschten" mir beide Füße weg.
Leise Aufschreie. Ich grinste Schubi an, machte einen Klimmzug und kletterte die letzten fünf Meter in betont atemberaubendem Tempo zu ihm.
 10. Von wackelnden Felsnadeln und abseilenden Höhlenspinnen (Auszug) 10. Von wackelnden Felsnadeln und abseilenden Höhlenspinnen (Auszug) 
...Nachdem wir am nächsten Morgen unsere Kater (ohne Fell) mit einem Kaffee Marke Herztod vertrieben und die anatomische Normallage unserer schmerzenden,
weil völlig verschobenen Knochen mittels Gymnastik wieder hergestellt hatten, gingen wir zur "Nadel". Dieser extrem schlanke Felszahn hat die Form einer
dreiseitigen Pyramide, die oben so spitz zuläuft, dass eine fast kreisrunde Fläche von höchstens 20 cm Durchmesser ihren oberen Abschluss bildet, gerade ausreichend
für die Gipfelbuch-Kassette. Beim Alten Weg musste man vom Massiv absteigen, rückwärts - also nach hinten, mal was ganz anderes - übertreten, sich umdrehen, rüber
ziehen und dann wieder ein paar Meter hoch klettern. Es dauerte keine fünf Minuten und Schubi war auf dem, nein, am Gipfel. Weil man ja auf diesem nicht wirklich
sitzen konnte, hing Schubi sich schwungvoll in die Abseilöse. Mir blieb fast das Herz stehen, weil es so aussah, als hätte der ganze Gipfel gewackelt. Aber bestimmt
hatte ich mich getäuscht und das war bloß der Wind in den aus unserer Sicht darunter stehenden Baumwipfeln gewesen. Um nicht so etwas wie: "Hättste gestern ein
bisschen weniger trinken sollen!" zu ernten, wollte ich dann lieber auch nichts sagen. Doch genau in diesem Moment würgte Martin mit starren Blick hervor:
"Macht das noch mal!" Als Schubi sich nach einem lakonischen "Wieso?" noch einmal, aber diesmal betont kräftig in die öse setzte, beförderten ihn unsere Schreie
und angststarren Augen in Sekundenbruchteilen AUF den Gipfel. Jetzt war das Schwanken nicht mehr zu übersehen. Und auch nicht Schubis mühsam niedergekämpfte Panik,
der ja wusste, in welch auswegloser Situation er steckte, wenn diese Felsnadel umkippte. Deren Gewicht hätte das Seil zerrissen und ihn mit in die Tiefe genommen.
Als der steile Zahn aufgehört hatte, zu schwingen, stiegen wir trotzdem nach. Schon aus Solidarität. Sowohl beim Aufstieg, als auch beim Abseilen bewegten wir uns
jedoch wie auf Glatteis: Ganz, ganz vorsichtig.
...Ende November hatten wir dann die Chance, mit der Höhlenforschergruppe Berlin eine Tour in den Harz zu unternehmen. Von Blankenburg aus, wo wir Quartier
in der Jugendherberge bezogen hatten, ging es in aller Herrgottsfrühe mit dem Bus nach Rübeland, wo wir dann nur 100 m von der berühmten Hermannshöhle entfernt
unsere mehr oder weniger zusammengebastelte Höhlenausrüstung angelegten. Achim, der Chef der Berliner Speläologen, wie sie sich vornehm nannten, sagte uns, dass
wir als Test erst einmal etwas kleines machen würden und ging mit uns zur "Bodeganghöhle". Nur ein Meter über dem Wasser-spiegel der Bode war ein Loch im Fels,
an dem ich achtlos vorbeigegangen wäre, weil es viel zu klein war, als das ein Mensch da hinein passen könnte. Achim grinste uns nur an, nahm seinen Helm wieder
ab und zwängte sich in das Mundloch (so heißt das im Fachjargon). Und obwohl seine Figur höchstens mit der eines schmalen Herings verglichen werden kann, dauerte
es eine ganze Weile, bis seine Füße verschwunden waren und er von innen rief, dass jetzt der nächste kommen könne. Als sich irgendwie keiner fand, der dieser
Aufforderung Folge leisten wollte, weil alle irgendwie damit beschäftigt waren, in den Himmel, auf den Boden oder auf ihre Hände zu schauen, sagte ich: "Jungs,
ich gehe als nächster. Da wo ich durchpasse, kommt ihr locker hinterher." Auch ich nahm meinen Helm ab, schob ihn so tief wie möglich in das finstere Loch hinein,
legte mich auf den Bauch und begann, hinein zu kriechen. Es war unvorstellbar eng. Ganz und gar nichts für Klaustrophobie-Patienten. Achim gab von innen Tipps.
Einen Arm vor, einen nach hinten, ausatmen, mit den Beinen schieben, Schlängelbewegungen machen, anhalten, einatmen. Nach ein paar Minuten hatte ich knappe zwei
Meter zurückgelegt und befand mich in einem Raum, wo man etwa so viel Platz hatte, wie unter einem Tisch. Hier sollte ich mich drehen und mit den Füßen zuerst in
das tiefer in den Berg führende Loch krauchen. Aber nur so weit, dass ich den nächsten sehen und ihm Ratschläge geben konnte. Mario schob sich jetzt schnaufend,
keuchend und stöhnend Zentimeter für Zentimeter durch das Mundloch. Diese Geräusche waren mir wohl bekannt, weil Mario diese in gleicher Form auch bei jedem
engen Kamin von sich gab, was ihm kurze Zeit den Spitznamen "Stöhni" eingebracht hatte. Erst jetzt sah ich, dass an der Decke des "Raumes" etwa 20 glänzend braune
Höhlenspinnen saßen. Als sein Kopf gerade so den "Geburtskanal" verlassen hatte, seilte sich genau über diesem eine unserer "niedlichen" Mitbewohnerinnen ganz
langsam ab. Da der arme Mario sich weder vor-, noch zurückbewegen konnte und auch ein Wegdrehen des Kopfes nur in höchst eingeschränkten Umfang möglich war,
pustete er in wilden Stößen schräg nach oben in Richtung Spinne, damit diese ihre Entscheidung vielleicht doch noch einmal überdachte und wenigstens im Abseilen
innehielt. Völlig unbeeindruckt landete sie jedoch sanft auf seinem Mundwinkel, krabbelte genüsslich ein paar Kreise über sein mittlerweile stark verzerrtes und
hochrotes Gesicht, um ihren Weg dann auf dem Höhlenboden fortzusetzen. Mario rief: "Zieht mich raus!" Als keine Reaktion erfolgte, brüllte er. Die draußen
zurückgebliebenen zerrten nun mit vereinten Kräften an seinen Füßen, bis Mario mit einem flutschigen "Plop!" wieder ans Tageslicht kam. Und auch wenn mir das
Einatmen in meiner beengten Position nur zum Teil möglich war, konnte ich mich vor Lachen kaum halten.
 12. Camillo und die Amselseekante (Auszug) 12. Camillo und die Amselseekante (Auszug) 
...Vor Aufregung konnte ich dann gar nicht richtig schlafen. Zwei, drei Stunden war ich dann aber doch eingenickt, als ich von sehr nahem und lautem
Gezwitscher geweckt wurde. Ich machte die Augen auf und sah keinen halben Meter von mir entfernt eine Meise auf dem Kopf meines schlafenden Nachbarns
sitzen, die mit der Bommel seiner Pudelmütze spielte. Tsi-tsi-dä, tsi-tsi-dä (irgendwie so hört sich eine Meise an), Schnabel gegen die Bommel, die rollte
ein Stück zur Seite, dann wieder zurück und das Spiel begann von vorn. Sah die Meise in der Bommel ein seelenverwandtes Wesen? Egal, schon nach kurzer Zeit
konnte ich mein Lachen nicht mehr halten und prustete laut los. Die Meise erschrak und flog weg, der Pudelmützenträger wachte auf. Ich sollte erzählen, was
passiert war und obwohl ich kichernd flüsterte, wachten noch mehr Leute auf. Das wäre sowieso nicht zu verhindern gewesen, weil im gleichen Moment irgendjemand
auf dem Tisch herumhämmerte. Tack-tack-tack-tack-tack. Und wieder. Und noch einmal. Wir konnten nichts sehen, weil der Tisch um die Ecke stand. Aber das musste
der Specht sein, der sich an was auch immer versuchte. Hörte sich irgendwie metallisch an. Jemand brummte im Halbschlaf, dass er eine Fischbüchse auf dem Tisch
habe stehen lassen. Aber das würde der Specht nicht schaffen, sondern sich einen Korkenzieherschnabel und große Kopfschmerzen holen. Wieder kicherten alle bei
der Vorstellung, wie so ein Vogel wohl aussehen würde. Ich behielt die Augen offen und träumte vor mich hin. Gerade, als unser hämmernder Kollege seinen
wahrscheinlich erfolglosen Versuch aufgegeben hatte, fing es an, auf dem Tisch zu rascheln. Ich maß dem keinerlei ernsthafte Bedeutung bei, weil wir unseren
Proviant ja immer vor eventuellen Räubern schützten, indem wir jeder einen Stock in ein Loch der überhängenden Boofenwand steckten, an dem wir dann unseren
Essensbeutel aufhängten. Ich sah ein Eichhörnchen aus der Boofe herausflitzen. Nach kurzer Zeit kam es wieder, irgendetwas raschelte, Kollege Eichhorn flitzte
wieder. So ging das ein paar mal. In dem Moment, als mein noch sehr träge funktionierendes Gehirn mir nach ein paar Minuten mitgeteilt hatte, dass Eichhörnchen
doch nicht doof seien und das alles einfach nur so zum Spaß machten, blieb es zum Beweis dieser Erkenntnis auf seinem Weg aus der Boofe stehen, nahm einen
sauber abgebrochenen Riegel Schokolade aus dem Schnäuzchen in eine Pfote, putzte sich mit der anderen die Nase und rannte dann weiter.
Als wir kurz darauf aufstanden, sahen wir das ganze Ausmaß des "Mundraubes". Von der Schokolade lag nur noch die Unterseite der Verpackung auf dem Tisch, an
der Butter hatte sich auch sämtliches Getier gütlich getan und der Specht hatte es wirklich geschafft, drei nebeneinander liegende Löcher in die Fischbüchse
zu hacken, durch die er dann sämtliche Tomatensoße ausgezutscht hatte. Na wenigstens war unseren Essensbeuteln nichts passiert. Dachten wir. Unter einem lagen
lauter Krümel. Und bei genauerer Betrachtung stellten wir fest, dass unten ein Loch war, durch das man komplett durch den Beutel nebst Inhalt nach oben hindurch
sehen konnte. Nachdem wir alles ausgepackt hatten, konnte man das Brot, die Butter, die Salami und den Käse wie ein dreidimensionales Puzzle wieder zusammenlegen,
wobei die Richtschnur hierfür der durch das gesamte Essen hindurchführende Tunnel war. Das musste ein Bilch gewesen sein. Ein Tier so ähnlich wie ein
Siebenschläfer, dass in der Sächsischen Schweiz aus mir nun verständlichen Gründen mit Vorliebe Boofen bewohnt.

Der Boofenbilch nebst Abendbrot
 18. Von röhrenden Hirschen und super Abkürzungen (Auszug) 18. Von röhrenden Hirschen und super Abkürzungen (Auszug) 
...Dann wurde Holz gesammelt. Das war hier um vieles einfacher, als in unseren anderen Klettergebieten. Es lag so viel rum, dass man regelrecht aufpassen musste,
um sich nicht die Beine zu brechen. Unser Feuerchen war natürlich dementsprechend, so dass wir es bald nur noch mit ein paar Meter Sicherheitsabstand aushielten.
Leider hatten wir es versäumt, unsere Margarine und die zum Trocknen auf die warmen Steine gelegten Socken auch etwas weiter aus der "Kernbrennzone" zu entfernen.
Die schon flüssige Margarine ergoss sich aus ihrer schützenden Plastikbehausung, nachdem auch diese aufgegeben hatte, auf ihrem festen Aggregatzustand zu beharren.
Die Socken waren an der Nahtstelle zwischen der auf dem Fels liegenden und der Oberseite so sauber durchgebrannt, dass wir jetzt zwei identische Hälften von jeder
hatten. Also nichts mehr mit "Reinschlüpfen und sich wohl fühlen".
Wir hatten uns gerade in unsere Schlafsäcke gekuschelt, der Filmvorführer in unserem Kopf hatte sich entschieden, welchen Traum er denn heute zeigen wollte,
als es plötzlich markerschütternd durch das ansonsten totenstille Tal röhrte. Während ich mich aufsetzte, sah ich im Schein der letzten kleinen Flämmchen unseres
ehemals so großen Feuers, dass es mir die anderen drei gleich taten. Das zweite Röhren hatte dann zur Folge, dass mir am ganzen Körper die Haare zu Berge standen,
die stritten sich regelrecht um einen Standplatz. "Was ist das denn? Ein Bär?", fragte ich in die darauf folgende Stille hinein. "Doch nicht so laut! Hört sich an,
wie der Berggeist persönlich.", antwortete jemand. Noch ein Röhren. Langsam bekam ich es mit der Angst zu tun. Weil das ganze Tal nur so von Echos wiederhallte,
konnte man auch nicht abschätzen, wo sich der Verursacher dieser stimmgewaltigen Laute, die die Geräusche in jedem Horrorfilm verblassen ließen, befand. Er hätte
direkt neben uns stehen können. Ich starrte in die Dunkelheit. Irgendwann kam jemand die Idee. "Das ist ein röhrender Hirsch, die haben jetzt Brunftzeit!" Da uns
diese Erklärung plausibel erschien, legten wir uns wieder hin in der Hoffnung, unser herumbrüllender Geweihträger würde möglichst bald in eine andere Schlucht
seines Reviers wechseln, um dann dort die Nachtruhe zu stören. Aber den Gefallen tat er uns nicht. Auch weil sich mit unendlich weit erscheinenden Art- und
Leidensgenossen bald ein "Gespräch" oder "Um-Die-Wette-Röhr-Wettbewerb" anbahnte. "Der muss doch irgendwann einmal heiser werden!", brummte Martin aus seinem
Schlafsack. Aber erst ein paar Stunden später, nachdem er wahrscheinlich alle Mitbewerber und vor allen Dingen alle Hirschkühe in der halben Sächsischen Schweiz
akustisch von seiner Manneskraft überzeugt hatte, entfernte sich das Röhren langsam. Endlich konnten wir schlafen.
...Beim Abendessen fiel dann jemand ein Brot in den Sand der Boofe. Es wurde aufgehoben, ein bisschen abgewischt, saubergepustet, dann aufgeschnitten und gegessen.
Große Augen bei Sylvie. Aber erstens hatte keiner von uns auch nur ein Gramm Proviant zuviel in die Berge geschleppt, wir hatten also nichts anderes, und zweitens
schmeckte das Brot uns ausgehungerten Kerlen trotz des leichten Knirschens zwischen den Zähnen hervorragend. Außerdem soll ja Sand den Magen reinigen. Auch die
Menge – oder besser: Unmenge – Knoblauch, die wir in die Suppe schnippelten, erschien ihr eher nicht normal. Dann fragte sie vorsichtig, wo und wie sie sich denn
waschen könne. Jemand aus unserem Kreis um das Feuer sagte ihr, dass sie sich ihr Handtuch, ihr Waschzeug und idealerweise auch eine Laschentampe schnappen müsse
und dann einfach auf dem Weg, den sie hochgekommen war, wieder bis zur Elbe herunterlaufen müsse. Dass das aber auch eher wenig Sinn machen würde, weil sie nach
dem Aufstieg wieder so verschwitzt wäre, dass sie gleich wieder umdrehen könnte. Wir würden sie dann morgens von ihrem ewigen Herunter- und wieder Hochgelaufe
erlösen. Sylvie fragte vorsichtig nach etwas Wasser aus unseren Kanistern, was aber einstimmig und mit lautem Protest abgelehnt wurde. Wir hätten gerade einmal
zehn Liter für sieben Leute und das musste für noch ein Süppchen und zum Trinken reichen. Na gut, wenn sie das hierfür unbedingt bräuchte, könnte sie vielleicht
einen Schluck (aber nur einen!) zum Zähneputzen haben.
Frühmorgens gegen fünf Uhr bekam sie den nächsten Eindruck davon, dass wir wohl nicht ganz normal sein konnten. Um diese Zeit weckte Axel mich nämlich immer,
damit wir vor dem Frühstück noch schnell einen Weg machen konnten. Diese Begeisterung für’s Klettern konnte sie natürlich noch nicht teilen, zeigte uns einen
Vogel und drehte sich auf die andere Seite. Sicher war es dann auch ungewöhnlich für sie, dass wir beide jeder als kleinen Snack zu unseren Frühstücksbroten
eine viertel bis halbe Knolle (nicht Zehe!) Knoblauch wegknabberten.
...Die meisten Züge, mit denen wir von Dresden aus weiter fahren mussten, kamen übrigens aus Prag, Wien oder Budapest. Wie bekam man da drin einen Sitzplatz?
Ganz einfach, man guckte von draußen, in welchem Abteil Leute aussteigen wollten, klopfte gegen das Fenster, bat die anderen Leute drin, das zu öffnen und
kletterte da rein. Dann reichte man die Kraxen hinterher und blockierte damit die Sitzplätze. Alle anderen konnten dann ganz gemütlich durch die Tür einsteigen.
Aber auch, wenn das einmal nicht klappte, brauchten wir nur einen einzigen Sitzplatz im Abteil, den dann Axel oder ich einnahmen. Meistens wollten die dort
drin sitzenden Leute spätestens drei Minuten später lieber den Rest der Fahrt auf dem Gang stehen. Ganz hartgesottene schafften es zehn Minuten. Wir machten
es uns gemütlich und unser Knoblauch-"Duft" sorgte dafür, dass niemand in unserem Abteil sitzen wollte, egal, wie voll der Gang war. Nicht mal für den Schaffner
war das auszuhalten. Tür auf, "Guten Tag! Die Fahrk...uaaaah!", Tür zu.
 23. Zwei furchteinflößende Nachterlebisse (Auszug) 23. Zwei furchteinflößende Nachterlebisse (Auszug) 
...Es ist kein wirkliches Vergnügen, eine III bei völliger Dunkelheit, ungesichert und mit einer Taschenlampe zwischen den Zähnen zu klettern. Ohne triftigen
Grund wäre das auch Wahnsinn. Einmal wurde mir auch sehr mulmig, als ich mich am Ende des zweiten Kamins von einem Pfeiler auf den Gipfel ziehen musste. Aber
ich dachte an meine zwei, in irgendwelchen Kaminen frierenden Freunde, gab mir einen Ruck und war oben. Erst einmal zur gegenüberliegende Talseite brüllen.
Von irgendwo her das Echo eines unverständlichen Schreiens, das sich nach Tino anhörte. Da der Gipfel von drei Kaminen gespalten war, musste ich jetzt in jeden
einzelnen hinein rufen. Der erste - nichts, der zweite - auch nichts, im dritten bekam ich irgendwo tief unten eine Antwort. Mein Gott, so weit weg war Tino
noch von mir? Also dort hinein klettern. Ach du Schreck, der Kamin war oben mehr als 3 m breit und verengte sich erst allmählich - unmöglich, da hineinzukommen.
Also hinein seilen. Aber eine Abseilöse war nicht zu finden. Und die Bäumchen auf dem Gipfel waren alle so mickrig, dass sie nicht einmal das Gewicht des Seiles
gehalten hätten. Was jetzt? Die III wieder runter und Tino von unten mit warmen Klamotten und heißem Tee versorgen, bis es wieder hell wurde? Aber diesen Weg im
dunklen wieder zurück zu klettern wäre nun wirklich der blanke Wahnsinn gewesen. Hier muss doch irgendwo eine Abseilöse sein! Beim Suchen fiel mir ein breites
Band etwa 12 m unter mir auf, das den ganzen Gipfel umspannte und auf dem oberhalb von "Tinos" Kamin zwei kleine Bäumchen wuchsen, die vielleicht als
Befestigungsmöglichkeit fürs Abseilen in Frage kamen. Vielleicht könnte ich ja in einem der ersten beiden Kamine abklettern und auf dem Band dorthin queren?
Das könnte klappen. Mitten im Abstieg kam mir der Gedanke, was passieren würde, wenn mir jetzt die Taschenlampe herunter fiele. Dann hätten wir alle drei die
ganze Nacht lang, wie der Berliner sagt "die Brille uff". Und bestimmt hätten wir das nicht alle drei überlebt. Sylvie wäre bestimmt zuerst erfroren. Also zog
ich schnell eine Sicherungsschlinge durch den Bügel der Taschenlampe und klinkte sie an meinem Gurt fest. Oberhalb von "Tinos" Kamin musste ich dann noch ein
paar erdige Meter herunter rutschen, die zum Glück schnee- und eisfrei waren. Zum gleichen Glück konnte ich die Höhe, in der ich mich jetzt befand, in der
Dunkelheit nicht sehen. Natürlich war mir klar, dass ich einen Fehler mit meinem Leben bezahlt hätte. Als ich dann direkt vor den Bäumchen im Dreck saß, wurde
mir ganz anders. Aber mir blieb nichts weiter übrig, als mein Seil um einen knapp10 cm dicken toten Birkenstamm und ein unterarmstarkes Kieferchen zu legen.
Ganz vorsichtig setzte ich mich in das Seil, immer darauf bedacht, in den Kamin zu fallen, um mich dort irgendwie zu verkeilen, wenn die Bäumchen mein Gewicht
nicht hielten. Eine Weile später saß ich in meinem Seil neben dem mittlerweile schon fast apathischen Tino, holte beim weiteren Abseilen alle seine Schlingen
heraus und gab, überglücklich, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, das übliche Kommando "Seil frei!" Ich ordnete das ganze Seilzeug und machte mich
langsam zum gehen fertig. Nanu, warum kam denn Tino nicht? "Was is’n los, Tino? Wartest du auf besseres Wetter?" Leise, klägliche Antwort: "Leuchtest Du mir
mal bitte?" Kein Wunder, dass seine Moral total am Tiefpunkt war. Als wir dann alle Seile abgezogen, zusammengelegt und uns umgehängt hatten, beeilten wir uns,
Sylvie aus ihrem Eisloch zu holen.
 30. Von Schmelzkäse-Eis und Herzschrittmacher-Problemen (Auszug) 30. Von Schmelzkäse-Eis und Herzschrittmacher-Problemen (Auszug) 
Unsere Wintertour im Januar 87 schlug nun wirklich dem Faß den Boden aus. Nachttemperaturen von –21° hätten jeden halbwegs vernünftigen Menschen davon
abgehalten, draußen schlafen zu wollen. Nicht aber uns. Mittlerweile hatten sich die meisten zwar schon einen Daunenschlafsack anfertigen oder von einer
West-Oma schicken lassen, trotzdem war es immer noch komplett verrückt. Als wir alle unsere Schlafplätze fertig machten, fiel Ewu auf, dass er seinen
Schlafsack zu Hause vergessen hatte! Und was nun? Das einzig Vernünftige wäre gewesen, wieder zurückzufahren. Wir hatten eine andere Idee. Wir legten alle
unsere Kraxen als unterste Schicht unter Ewus Isomatte – wenigstens die hatte er mitgenommen - und darauf die Hälfte unserer ganzen Klamotten. Das alles
verschoben wir so, dass seine Füße nur etwa einen Meter von der Feuerstelle entfernt sein würden. Dann gaben wir ihm alle unsere Reservepullover, unsere Jacken,
Mützen, Hosen und dicken Socken. Als er sich dann hingelegt hatte (und aussah, wie ein Sumo-Ringer oder das Michelin-Männchen), deckten wir ihn mit all dem,
was er nicht mehr hatte anziehen können, zu. Links und rechts neben ihm rutschten wir in unseren Komfort-Schlafsäcken ganz dicht an ihn heran. Und: Er hat es
nicht nur gut überstanden, sondern sogar hervorragend geschlafen. So, wie wir alle. Sogar die beiden Mädels hatten nicht gefroren. Und das will ja schon was
heißen. Das einzige Problem war immer die Nase. Hat man die nämlich zu tief im Schlafsack, ist die Luft zwar warm, aber bald sehr sauerstoffarm. Steckt man
sie nur einen Zentimeter zu weit nach draußen, hat man viel Sauerstoff. Und bald eine gefrorene Nase.
Morgens wurde natürlich zuerst wieder das Feuerchen entfacht, dann wollten wir uns ein paar Frühstücksstullen machen. Nachdem der erste allerdings sein Brot
ausgepackt hatte, sich das Messer aber keinen Millimeter dort hineinschnitt und nachfolgende Drück- und Klopftests ergaben, dass das komplett durchgefroren war,
erwies sich dieses Vorhaben als undurchführbar. Abhilfe hätte ein Samuraischwert gebracht, aber ausnahmsweise hatte keiner von uns eins dabei. Natürlich befand
sich alles andere auch in diesem Aggregatzustand. Sogar der Rotwein in den Flaschen hatte mittendrin ein Stück Eis und außenherum eher eine Konsistenz wie roter
Schnee. Also haben wir Schnee – nicht den roten aus der Flasche, sondern den weißen, von dem ja außerhalb der Boofe ausreichend, faul und sinnlos in der Gegend
herumlag - im Topf aufgetaut, um uns ein Süppchen zu kochen. Die Würstchen und Zwiebeln, die da wie immer mit hineingehörten, mussten wir vorher regelrecht in
Wursteis- und Zwiebeleis-Stücke zerschlagen. Lange kämpfte der Kocher gegen die auch für ihn ungewohnten Umgebungstemperaturen, bis die ersten Siedebläschen im
Topf lautes Siegesgeheul bei uns auslösten. Bei solchem Frost eine Suppe oder später dann einen heißen Tee mit Rotwein zu schlürfen, entpuppte sich als ein
unbeschreibliches Vergnügen. Und nachdem Lutschversuche mit Schmelzkäse-Eisstückchen für lange Gesichter gesorgt hatten, kam Schnolle eine bessere Idee: Er tat
diese zusammen mit seiner zerschlagenen Sülze in einen weiteren Topf und brutzelte das auf. Besser kann ein Ragout fin gar nicht schmecken.
Dann wanderten wir los. Unter den Felswänden Schneeverwehungen von fast fünf Metern Höhe, oben an den Wänden Eiszapfengalerien in ebensolcher Länge. Auf
einzelne Zapfen ließ sich ein prima Zielwerfen veranstalten. Gewinner war natürlich der, dessen Schneeball den Zapfen mit lautem Krachen zu Boden beförderte.
Und wo der Schnee als größere Fläche wie eine Gletscherzunge über eine Felskante hing, versuchten wir natürlich auch, ihn von seinem Leiden des
Ständig-Herumhängen-Müssens zu befreien. Das ging gut von unten und dann später auch von oben. Auch Ringe in den Wänden waren gute Zielscheiben, so lange, bis
sie mit Schnee völlig zugepappt waren. 99 Punkte bekam nur der, bei dem der Schneeball durch den Ring an die Wand klatschte, ohne ihn zu berühren. Oder die Bäume
weit unter uns, wo plötzlich jemand erklärte, dass der dritte von links Schneemassen der höchsten Lawinengefahr-Stufe trug, wir diese drohende Gefahr für alle
Städte elbabwärts beseitigen müssten und ihn deshalb so lange bewarfen, bis er ganz schwarz, weil schneelos, aus seinen weißen Nachbarn herausragte. Sieben Leute
können auch eine prima Schneeballschlacht veranstalten. Auf jeden Fall hatten wir den ganzen Tag lang Spaß ohne Ende. Das einzige, was wir klettertechnisch
gemacht hatten, war das Begutachten der Wege an jedem Gipfel neben unserem Weg. Für bessere Zeiten.

Schnolle und Micha nach erfolgreichem gegenseitigen "Einseifen". And the winner is: Gar keiner
...Im März wollten wir trotz schrecklichen Tauwetters versuchen, am weit abgelegenen Zschirnstein die sieben dort gelegenen Gipfel abzuhaken. Nichts ging.
Alles viel zu nass. Also genehmigten wir uns beizeiten ein leckeres Abendbrot in der Kneipe des nahe gelegenen Dörfchens. Nachdem wir dann auch noch alle
Kräuterschnäpse, die auf der Karte standen, durchprobiert hatten, war es stockfinster. Normalerweise ja kein Problem, denn wir hatten zwei Taschenlampen mit.
Nur, dass die eine gar nicht anging und die Batterien der anderen so schwach waren, dass sie nur noch ein mattes gelbes Licht produzierten, das nicht einmal
ausreichte, um den Boden vor einem zu beleuchten. Dann besser gar kein Licht, damit sich die Augen an die Dunkelheit des Waldes gewöhnen konnten. Es war jedoch
so finster, dass man schon eine Katze im Stammbaum haben musste, um überhaupt irgendetwas zu erkennen. Und obwohl die Millionen funkelnder Sterne über uns ihr
Bestes gaben, den Weg auszuleuchten, half das keinen Deut weiter. Wenigstens orientieren konnte man sich an den Himmelsausschnitten zwischen den Baumwipfeln.
Das brauchten wir auch, weil wir den Weg, den wir hochgingen, außer vom Hinweg nicht kannten. Zum Glück hatte wenigstens ich ein fast unbeirrbares
Orientierungsvermögen. Und so stapften mir alle hinterher. Ansonsten war es totenstill. Bis es auf einmal keine zehn Meter von uns entfernt massiv raschelte
und dann etwas mit lauten Hufschlägen wegrannte. Unsere Herzschrittmacher brauchten eine Weile, bis sie dem Herz wieder einen Schritt gemacht hatten. Und bei
den schlotternden Beinen dauerte das wegen der größeren Entfernung zu diesem hilfreichen Gerät natürlich noch entsprechend länger. Außerdem heißt der ja
nicht Beinschrittmacher, was übrigens eine tolle Erfindung wäre. Schon bald konnten wir – im wahrsten Sinne des Wortes – der Nase nach laufen. Weil man die
Boofe, oder besser gesagt, die Feuerstelle in ihr, wenigstens auf den letzten 200 Metern riechen konnte.
Wir setzten uns in die Dunkelheit – ein Feuer hätten wir sowieso nicht anbekommen, weil alles viel zu nass war - und tranken noch ein Flascherl Wein. Dann,
als wir uns gerade so in unsere – auch ziemlich klammen – Schlafsäcke gekuschelt hatten, hörten wir statt des erwarteten Nichts irgendetwas weit entferntes,
undefinierbares, da nicht hinpassendes. Wir hätten dem keine ernsthafte Bedeutung beigemessen, wenn sich dieses sehr baßlastige Geräusch nicht langsam, aber
bestimmt in unsere Richtung bewegt hätte. Da saßen wir nun und lauschten in den kohlrabenschwarzen Wald. Als das schon deutlich angestiegene Gebrummel dann
langsam in einzelne Töne aufzulösen war, flüsterte eine Stimme aus der Dunkelheit "Scheiße! Wildschweine!" So ein Mist, dachte ich mir, die können doch unser
Essen riechen. Hoffentlich übertüncht der Geruch des Feuers das ein bisschen. Aufatmen, als sich das Getrappel dafür entschied, jetzt nach links auszuweichen.
Haha! Zu früh gefreut! Unsere mittlerweile wie bei Fledermäusen aufgestellten Ohren signalisierten nämlich dem Angstzentrum im Gehirn, dass sich das
bedrohliche Etwas zwar dort nach oben bis zur Felswand bewegt hatte, sich dann aber dafür entschieden hatte, sich jetzt immer an der Wand entlang auf uns
zuzubewegen. Wie schön wäre jetzt eine Taschenlampe gewesen. So griff sich jeder etwas, dem er gerade habhaft wurde. Knüppel, Steine, was auch immer, ich
entschied mich für ein Feuerzeug. Was für eine Waffe! Wenn der Keiler vor einem steht, einfach mit dem Flämm-chen blenden und schon hat der panische Angst
und zieht sich halbblind zurück. An irgendetwas muss man ja in einem solchen Moment glauben. Wir schafften es nicht einmal, aus den Schlafsäcken zu krauchen
und aufzustehen. Schon rannte die ganze Rotte an unserer Boofe vorbei. Keine zwei Meter von unseren Füßen entfernt. Jedenfalls nach unserem akustischen Empfinden.
Das optische meldete: Ich seh’ nichts, also ist da nichts. Gar nichts. Nur schwarz. Ich denke, keiner von uns hat auch nur leise geatmet. Vielleicht konnten
Wildschweine ja trotz des infernalischen Getrappels ein Atemgeräusch hören? Als auch noch der letzte Nachkömmling vorbeigewetzt war, mussten unsere
Herzschrittmacher wieder ganze Arbeit leisten.
|
 Leseproben aus „Splittergruppe…” Teil 1
Leseproben aus „Splittergruppe…” Teil 1